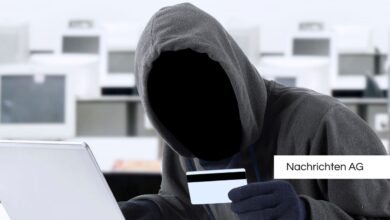Mitteldeutschland hat eine lange Geschichte im Bereich des Braunkohlebergbaus, die bis ins frühe 20. Jahrhundert zurückreicht. Die Region wurde zu einem Zentrum für den Bergbau und die chemische Industrie und hat sich somit eine Vorreiterrolle in der Raumplanung erarbeitet. Ähnlich dem Ruhrgebiet präsentiert sich Mitteldeutschland heute als Beispiel für die Herausforderungen und Chancen, die mit dem Strukturwandel verbunden sind. Professor Harald Kegler von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg hebt die Pionierleisung dieser Region im Bereich der modernen Landesplanung hervor.
Ein bedeutendes Datum in dieser Geschichte ist der 2. April 1925, an dem in Halle der „Landesplanungsverband für den engeren mitteldeutschen Industriebezirk“ gegründet wurde. Dieser Verband vereinte Vertreter aus Wirtschaft, Landwirtschaft und Kommunen. Im Jahr 1927 stellte Gustav Langen in Leipzig den Begriff der Raumordnung vor, was einen Wendepunkt in der Diskussion über die „industriell geprägte Kulturlandschaft“ in Thüringen darstellte. Der Plan 23, auch bekannt als Planungsatlas Mitteldeutschland, wurde 1932 veröffentlicht und legte wichtige Grundlagen für die Energie- und Wirtschaftsstruktur der Region.
Die Entwicklung des Braunkohleabbaus in der DDR
In der DDR wurde eine radikale Braunkohlepolitik angestoßen, um die Energieautarkie zu gewährleisten. Nach der Ölkrise 1973 intensivierte die Regierung die Erschließung neuer Abbaufelder, was zur Zerstörung eines Drittels des Bezirkes Cottbus führte. Viele Familien lebten von der Braunkohleindustrie, was ein Dilemma zwischen Heimat und Arbeit erzeugte. Bis in die 1980er Jahre waren in der DDR 39 Tagebaue aktiv, die im Jahr über 300 Millionen Tonnen Braunkohle förderten und die DDR zum weltweit führenden Braunkohleproduzenten machten.
Mit der Wiedervereinigung kam es jedoch zu einem drastischen Rückgang der Beschäftigten in der Branche. Die Zahl sank von 700.000 Ende der 1980er Jahre auf gerade einmal 100.000 Anfang der 2000er Jahre. Zwischen 1989 und 1999 wurden 31 Tagebaue stillgelegt. Trotz dieser Entwicklungen bleibt Deutschland einer der größten Braunkohleproduzenten, wobei heute etwa die Hälfte der einst geförderten Menge abgebaut wird.
Auswirkungen des Kohleausstiegs
Der Bundestag verabschiedete im Juli 2020 ein Gesetz zum Kohleausstieg bis 2038, wobei die erste Abschaltung eines sächsischen Kohleblocks für 2029 vorgesehen ist. Ein Finanzabkommen zwischen der Bundesregierung und den Kohleländern sieht 40 Milliarden Euro Unterstützung für die Schaffung von Industriearbeitsplätzen vor. Dies geschieht im Rahmen eines Transformationsprozesses, der den Braunkohleregionen neue Perspektiven bieten kann.
Die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) ist verantwortlich für die Sanierung der durch den Braunkohleabbau geschädigten Landschaften. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat die LMBV rund 11,43 Milliarden Euro in die Braunkohlesanierung investiert. Projekte wie das „Lausitzer Seenland“ und das „Leipziger Neuseenland“ stehen beispielhaft für die erfolgreiche Rekultivierung der ehemaligen Abbauflächen.
Trotz der Herausforderungen, die mit dem vorzeitigen Kohleausstieg verbunden sind – unter anderem, dass Unternehmen möglicherweise nicht über ausreichende Mittel für die Renaturierung verfügen – wird die Rekultivierung als vorbildlich angesehen. Die Schaffung neuer Kultur- und Naturräume aus ehemaligen Tagebaurestlöchern stellt ein einzigartiges Langzeitexperiment dar, dessen Ausgang ungewiss ist.
Professor Kegler fasst die Entwicklungen in Mitteldeutschland zusammen, indem er betont, dass die ursprünglichen Pläne von den 1920er-Jahren eine neue „industriell geprägte Kulturlandschaft“ anstreben, die den Bedürfnissen von Mensch und Umwelt gerecht wird. Die Herausforderung heute ist, diese Vision in die Realität umzusetzen.